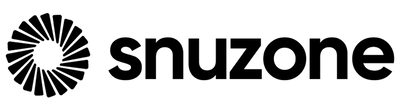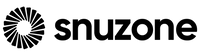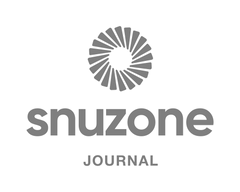Rauchen aufhören - dies gilt vielen als schwieriges Unternehmen. Es sind meist aber nicht bloß die Symptome durch einen Nikotinentzug, welche den Ausstieg erschweren. Diese lassen sich schließlich auch mit Medikamenten oder Nikotinersatzprodukten in den Griff bekommen. Vielmehr spielen hier psychosoziale Dynamiken eine wesentliche Rolle. So kann es zahlreiche soziale Faktoren geben, die einen Konsum begünstigen und einen Ausstieg folglich erschweren - beispielsweise Gruppenzugehörigkeit und Geselligkeit durch das Rauchen im eigenen Umfeld. Besonders nämlich dann, wenn zusätzlich psychische Faktoren als stark konsumtreibende Kräfte wirksam werden - insbesondere können hier sogenannte "maladaptive Schemata", sozusagen dysfunktionale Kognitive- und Verhaltensmuster, den Konsum ungünstig befeuern, wenn entsprechende Schlüsselreize wirken.
>> Hier erfährst du mehr über: Rauchen aufhören Medikamente
Die Gründe für einen schwierigen Ausstieg sind also komplex und lassen sich nicht nur auf mögliche Entzugssymptome reduzieren. Dass man hier mindestens drei Ebenen mitdenken sollte, auf welchen sich begünstigende, wechselseitig aufeinander einwirkende Faktoren für den Raucheinstieg, -fortbestand und schließlich einen schwierigen -ausstieg finden lassen, legt das sogenannte Biopsychosoziale-Modell nahe. Ein Nikotinabusus lässt sich damit auch holistisch verstehen.
Psychotherapeutische Verfahren setzten bei ebensolch psychosozialen Gesichtspunkten an - ein Beispiel hierfür ist die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT). Und obwohl es eine professionelle Psychotherapie niemals ersetzen kann, lassen sich davon bestimmte Selbsthilfetechniken ableiten.
Selbsthilfetechniken aus der Psychotherapie als Hausmittel beim Rauchstopp
Als Hausmittel beim Rauchausstieg werden gemeinhin einfache häusliche Mittel und Maßnahmen zur Selbstmedikation verstanden. Allgemeiner formuliert kann ein Hausmittel hier aber auch eine Form einer zu Hause selbst umsetzbaren Lösung oder Anwendung einer Hilfestellung beim Rauchausstieg sein.
In ebendiesem Sinne gelten Selbsthilfetechniken aus der Psychotherapie als Hausmittel, wobei hier der Fokus weniger auf "Selbstmedikation" als vielmehr auf "Selbstintervention" gelegt wird.
Die Kognitive Verhaltenstherapie ist eine Psychotherapieschule, die bei einer Nikotinsucht und beim Rauchausstieg eine effektive Unterstützung bietet und nachhaltige Lösungen schaffen kann. Im Rahmen ihres Ansatzes lassen sich für den Klienten selbst umsetzbare, eine Abstinenz unterstützende Techniken ableiten - und diese können helfen, starre und ungünstige Konsum- und Verhaltensweisen wie deren Rahmenbedingungen zu lichten, aufzubrechen und schließlich zu modifizieren.
Situative Verhaltensanalyse: SORKC-Modell
Um sein Konsumverhalten nachhaltig modifizieren/beenden zu können, scheint es essenziell zu verstehen, welche Schlüsselreize den Konsum befeuern und wieso sie das tun. Außerdem kann es hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, welchen psychosozialen Mehrwehrt einem das Rauchen bringt - man kann den Rauchkonsum hier nämlich funktional verstehen. Wer raucht, dem fallen meist unmittelbare positive Konsequenzen durch seinen Konsum zu - sogenannte Verstärker. So gesehen gilt der Rauchkonsum als "telelogisches Phänomen", als ein Verhalten, welches zweck-/zielgebunden ist und sich alleine schon durch diesen zu erfüllenden Zweck verstärkt.
In der Kognitiven Verhaltenstherapie gilt die Verhaltensanalyse zu Beginn als ein Schlüsselmoment für die weitere Anwendung etwaiger Therapiemethoden. Dabei lässt sich zwischen einer sogenannten kontextuellen/vertikalen- und einer situativen/horizontalen Verhaltensanalyse unterscheiden.*1
 |
Mit einer Verhaltensanalyse lässt sich erst einmal ein Überblick über die komplexen Wechselwirkungen zwischen Kognition, Emotion sowie Verhalten geben, wobei sich so psycho-soziale Dynamiken lichten können. - © Bild: AdobeStock |
Speziell die horizontale Verhaltensanalyse kann nun in einer recht übersichtlichen Form lichten, inwieweit ein Konsumverhalten sowohl mit situativen Schlüsselreizen als auch individuellen maladaptiven Schemata und den mit dem Konsum einhergehenden Konsequenzen in Zusammenhang steht. Weiterfolgend lassen sich dann spezielle Methoden ableiten, die an unterschiedlichen Gesichtspunkten ansetzen und eine Hilfestellung beim Rauchstopp bilden.
Das SORKC-Modell beim Rauchen-aufhören
Ein anerkanntes Konzept der horizontale Verhaltensanalyse ist das sogenannte SORKC-Modell.*2 Dieses Modell mag erwähnt sein, um aufzeigen zu können, inwieweit die intendierten Selbsthilfetechniken sich ableiten lassen, und vor allem, wieso sie und in welcher Weise sie greifen.
Das SORKC-Schema setzt sich aus fünf Variablen zusammen:
| S ---> | O ---> | R ---> | K ---> | C |
- Stimulus (S): Umfasst situationsgebundene (Schlüssel-)Reize, die einem (Konsum-)Verhalten vorausgehen.
- Organismus (O): Umfasst individuelle biologische und lerngeschichtliche Grundlage einer Person - darunter fallen auch Grundüberzeugungen, Erwartungen und wichtige Bedürfnisse der erwähnten maladaptiven Schemata, welche, durch einen Schüsselreiz in der Stimulus-Variable aktiviert/vermieden/überkompensiert, zu bestimmten starren Reaktionen in der Reaktions-Variable führen.
- Reaktion (R): Hier werden alle beobachtbaren (vorrangig ersichtliches Verhalten) und nicht-beobachtbaren (kognitive, emotionale und physiologische) Reaktionen gefasst, die bedingt durch Faktoren aus der Organismus-Variable auf situative Stimuli folgen. Die Einteilung in sogenannte maladaptive Bewältigungs-Stile (flight, fight, freeze) kann dabei aufzeigen, ob maladaptive Schemata vermieden, überkompensiert oder aktiviert wurden.
- Kontingenz (K): Hier wird die Häufigkeit des zusammenhängenden Auftretens von Situation, Verhalten und Konsequenzen ausgedrückt.
- Konsequenz (C): Alle aus dem Verhalten resultierenden Belohnungen und Bestrafungen.
Was sind maladaptive Schemata?
Maladaptive Schemata sind ein Konzept von Jeffrey Young, welches sich folgendermaßen beschreiben lässt:
Jeffrey Young zufolge können maladaptive Schemata entstehen, wenn emotionale Grundbedürfnisse in Kindheit und Jugend wiederholt nicht erfüllt bzw. frustriert wurden. Klinisch und empirisch bestätigt sind 18 unterschiedliche Schemata, die fünf Domänen (oder Themen) zugeordnet werden, die wiederum das frustrierte Grundbedürfnis widerspiegeln.
Das Schema wird also in der frühen Individualentwicklung angelegt als überdauerndes und umfassendes Muster aus Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Körperempfindungen im Sinne eines inneren „Abbilds“ der realen Bedingungen in der frühen Biografie. Dieses Muster kann sich im Laufe der weiteren Entwicklung verstärken und wirkt bei Aktivierung handlungsleitend fort, auch wenn die äußeren Bedingungen und das Beziehungsgefüge sich ändern."*3
Von therapie.de werden maladaptive Schemata außerdem beschrieben als:
"Ein Schema umfasst dauerhafte, ungünstige Muster von Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen, die das Verhalten in einer konkreten Situation steuern. Die Schemata können sich auf den Betroffenen selbst (Selbstschemata) oder auf seine Beziehungen zu anderen Menschen (Beziehungsschemata) beziehen. Sie wirken sich ungünstig auf das Leben des Betroffenen aus und werden deshalb auch als „Lebensfallen“ bezeichnet."*4
Ergänzend lässt sich festhalten, dass solche Schemata die Wahrnehmung maßgeblich mitbestimmen.
Durch ungünstige Grundüberzeugungen, Erwartungen (an sich selbst oder an andere) und wichtige (unbefriedigte) Bedürfnisse können solch maladaptive Schemata auf der Organismus-Variable handlungsweisende Faktoren bezeichnen. Die entsprechenden beobachtbaren und nicht-beobachtbaren "maladaptiven Reaktionen"(flight, fight, freeze), welche durch ungünstige, handlungsleitende Grundüberzeugungen, Erwartungen und Bedürfnisse der Schemata entstehen, finden sich schließlich in der Reaktions-Variable. Die Schlüsselreize, durch welche maladaptive Schemata aktiviert, vermieden oder überkompensiert werden, lassen sich hingegen in der Stimuli-Variable situationsbezogen lichten.
Mit diesem Konzept können sohin dysfunktionale Handlungsmuster mit ihren Schüsselreizen, den dadurch aktivierten/vermiedenen/überkompensierten ungünstigen kognitiven und emotionalen Anteilen und den darauffolgenden Konsequenzen in Zusammenhang gebracht werden. Dadurch lässt sich erkennen und verstehen, was das eigene Konsumverhalten im Falle des Rauchens befeuert, leitet und wo sich Modifikationsansätze anbieten.
Hier nun eine Liste der 18 maladaptiven Schemata - mit ihren jeweiligen, üblichen Grundüberzeugungen (G), Erwartungen (E) und Bedürfnissen (B), wie sich diese in der Organismus-Variable fassen lassen*5:
-
Verlassenheit/Instabilität
- Andere sind unzuverlässig/instabil. (G)
- Werde verlassen/im Stich gelassen. (E)
- Bindung und Stabilität (B) -
Misstrauen/Missbrauch
- Andere sind nicht ehrlich, nutzen mich aus/sind manipulativ/verletzten mich. (G)
- Werde belogen/betrogen/gedemütigt/ausgenutzt/manipuliert. (E)
- Sicherheit und Vertrauen (B) -
Emotionale Entbehrung
- Andere können nicht emotional unterstützen/geben keine Zuwendung, Aufmerksamkeit/Verständnis/Schutz. (G)
- Ich werde abgelehnt/nicht verstanden/nicht geschützt. (E)
- Zuneigung, Empathie und Schutz (B) -
Unzulänglichkeit/Scham
- Ich bin unzulänglich/schlecht/unerwünscht/minderwertig/unfähig. (G)
- Werde von anderen nicht geliebt, respektiert, ausgegrenzt, benachteiligt, gedemütigt. (E)
- Liebe, Respekt und Selbstwert (B) -
Soziale Isolierung/Entfremdung
- Ich bin grundlegend anders als andere Menschen. (G)
- Werde nicht dazugehören/ausgegrenzt. (E)
- Zugehörigkeit, Integration in Gemeinschaft (B) -
Abhängigkeit/Inkompetenz
- Ich kann ohne Hilfe nichts bewältigen. (G)
- Das wird mich überfordern, ohne Unterstützung schaffe ich das nicht. (E)
- Selbstständigkeit, Kompetenz (B) -
Verletzbarkeit/Anfälligkeit für Schädigung oder Krankheit
- Etwas Schlimmes steht bevor. (G)
- Werde in Gefahr, hilflos sein. Verliere die Kontrolle. (E)
- Sicherheit, realistische Gefahreneinschätzung (B) -
Verstrickung / Unentwickeltes Selbst
- Ohne extreme Nähe zu anderen bin ich verloren. (G)
- Ohne Bindung werde ich orientierungslos sein. (E)
- Autonomie, Identität, eigene Ziele (B) -
Versagen
- Ich bin unfähig, dumm, minderwertig in Leistung. (G)
- Künftiges Versagen ist unvermeidbar. (E)
- Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen (B) -
Anspruchshaltung und Grandiosität
- Ich bin anderen überlegen, habe Sonderrechte. (G)
- Andere sollen sich meinen Bedürfnissen fügen. Erfolg, Macht und Berühmtheit. (E)
- Anerkennung realistischer Grenzen, Empathie (B) -
Unzureichende Selbstkontrolle / Selbstdisziplin
- Ich darf Impulsen nachgeben; Anstrengung vermeiden. (G)
- Die anderen werden es schon machen. (E)
- Selbstkontrolle, höherer Frustrations-Toleranz (B) -
Unterwerfung
- Ich muss mich anderen fügen/anpassen, um Konflikte zu vermeiden. (G)
- Wenn ich eigene Bedürfnisse/Emotionen zeige, werde ich abgelehnt oder bestraft. (E)
- Selbstbehauptung, Autonomie (B) -
Selbstaufopferung
- Die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als meine. (G)
- Wenn ich für mich sorge, habe ich Schuldgefühle/werde ich verlassen. (E)
- Ausgleich zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge (B) -
Streben nach Zustimmung und Anerkennung
- Nur durch Leistung, Anpassung oder Attraktivität bin ich wertvoll. (G)
- Wenn ich nicht gefalle, werde ich abgelehnt. (E)
- Stabiler Selbstwert, Authentizität (B) -
Negativität / Pessimismus
- Das Leben ist voller Gefahren, Enttäuschungen und Verluste (G)
- Schlechtes wird passieren, Gutes ist trügerisch. (E)
- Optimismus, Hoffnung, Balance von Positivem und Negativem (B) -
Emotionale Gehemmtheit
- Gefühle zeigen ist gefährlich oder peinlich. (G)
- Kritik, Ablehnung, Scham bei spontanem Ausdruck. (E)
- Freiheit, Emotionen zu zeigen, Spontaneität (B) -
Überhöhte Standards
- Ich muss immer perfekt sein und hohe Standards erfüllen. (G)
- Kritik oder Strafe bei Fehlern. (E)
- Akzeptanz, Gelassenheit, Selbstwert ohne Bedingungen (B) -
Bestrafen
- Fehler müssen streng geahndet werden – bei mir und anderen. (G)
- Keine Nachsicht; Strafe ist notwendig. (E)
- Vergebung, Toleranz, Mitgefühl (B)
Ebenso wie die individuelle Ausprägungsstärke eines speziellen Schemas (von leichten Ausprägungen bis hin zu pathologischen Formen) kann auch die Kombination des gleichzeitigen Auftretens mehrere Schemata zwischen einzelnen Personen stark variieren.*6
Was sind maladaptive Bewältigungs-Stile (coping-styles)
"Maladaptiv" bedeutet soviel wie "schlecht angepasst" respektive "unangepasst", wobei für maladaptive Schemata dadurch eine gewisse Dysfunktionalität impliziert wird, geht es um die Bewältigung von und den Umgang mit beispielsweise Stresssituationen. Obwohl ein dysfunktionales Bewältigungsverhalten impliziert wird, gilt ebendieses aber doch von den handlungsleitenden Schemata unterschieden und wird eher im Sinne von schemagesteuert verstanden.
Auf Jeffrey Young zurückgehend, werden dabei drei typische maladaptive Bewältigungsstile (Coping-Styles) unterschieden, die - wie gesagt - nicht zum jeweiligen Schema gehören, aber als Reaktionen auf dieses folgen und sich im Laufe des Lebens auch ändern können:
- Vermeiden (Flight): Der Flight-Stil bezeichnet die Bewältigung, indem man die vollständige Aktivierung des maladaptiven Schemas (EMS) meidet oder ihm entkommt. Typische Beispiele sind das offene Vermeiden oder Fliehen vor Menschen, Orten, Aktivitäten oder Situationen, die das Schema auslösen könnten, sowie Handlungen, die die unangenehme emotionale Erregung betäuben oder davon ablenken – etwa Drogenkonsum, andere zwanghafte Verhaltensweisen, Selbstverletzung oder emotionale Abspaltung.
- Überkompensation (Fight): Der Fight-Stil bedeutet, dass eine Person auf die Bedrohung durch die Aktivierung des Schemas reagiert, indem sie in gewisser Weise gegen die Kernbotschaft des EMS „zurückschlägt“. Das bedeutet: Denken, Fühlen und Handeln so, als ob das Gegenteil des Schemas wahr wäre. Neuere Autoren haben diesen Bewältigungsstil auch als „Schema-Inversion“ bezeichnet. Ein Beispiel: Jemand mit einem Unzulänglichkeit/Scham-Schema könnte überkompensieren, indem er Arroganz zeigt und sich so verhält, als sei er anderen überlegen (also das Gegenteil davon, sich minderwertig zu fühlen).
- Sich-Fügen/Unterwerfung (Freeze): Der Freeze-Stil beinhaltet die Resignation gegenüber dem Schema – die Kernbotschaft des EMS wird akzeptiert und man verhält sich so, als ob sie zuträfe (Grundüberzeugungen, Erwartungen und damit einhergehende Emotionen und Kognitionen werden also aktiviert). Ein Beispiel: Jemand mit einem Verlassenheits-/Instabilitäts-Schema könnte sich ergeben, indem er unsichere oder instabile Beziehungen sucht oder eingeht (in dem Glauben, dass kein Partner ihm je konsequent verlässliche emotionale und körperliche Verfügbarkeit geben wird). Solche Personen glauben möglicherweise, sie „sollten nichts Besseres erwarten“. Alternativ kann die Unterwerfung auch in einer eigentlich gesunden Beziehung stattfinden – etwa indem man ständig nach Bestätigung sucht oder den Partner kontrolliert, weil man dem Schema „glaubt“, das sagt: „Früher oder später wird mein Partner mich verlassen“ – selbst wenn es keinerlei objektive Belege dafür gibt.*7
Für den Rauchkonsum besonders interessant scheint der Flight-Stil zu sein, kann mit diesem doch das Konsumverhalten im Sinne einer "Flucht" respektive "Ablenkung" von einer vollständigen Aktivierung des EMS und einer "Dämpfung" der unangenehmen emotionalen Erregung durch die beruhigende Nikotin-Wirkung verstanden werden; obwohl es denkbare Fälle gibt, in welchen sich ein Rauchkonsum durch die anderen beiden maladaptiven Bewältigungs-Stile erklären ließe.
Fiktives Beispiel eines Rauchers
Mit einem fiktiven Beispiel eines Fußballers, der in bestimmten Stresssituationen unweigerlich zur Zigarette greift, will nun konkretisiert werden, wie sich mit dem SORKC-Schema eine horizontale Verhaltensanalyse verstehen lässt, wie sich dabei psychosoziale, einen Rauchkonsum begünstigende Dynamiken lichten lassen und wie schließlich mögliche Selbsthilfetechniken abgeleitet werden könnten.
Wichtig: Obwohl dies in keinem Fall mit einer professionellen Kognitiven-Verhaltens-Therapie verglichen werden kann, mag dabei doch oberflächlich eine Orientierungshilfe, ein Ratgeber sozusagen, gegeben sein.
H, der Fußballer, der vom Rauchen nicht loskommt:
 |
"H", ein begnadeter Fußballer, greift immer wieder zur Zigarette - speziell nach Niederlagen seines Teams nimmt der Konsum dann Überhand. - © Bild: AdobeStock |
- Stimulus (S): Die Fußballmannschaft von H verliert ein wichtiges Spiel, wobei H im Spiel eine wichtige Torchance verpasst hat.
- Organismus (O): H hat in seinem Leben nie wirklich gelernt, mit Niederlagen und Verlusten umzugehen. Zudem wurde H in der Schulzeit von einem seiner Lehrer benachteiligt und als er den Wunsch äußerste, gerne einmal zu studieren, wurde ihm nahegelegt, dass er dies sowieso nicht schaffen könne. Heute hat H oft das Gefühl, unfähig zu sein und in seinem Leben noch nichts erreicht zu haben. Im Fußball fühlt er sich bei Erfolgen aber besonders bestätigt und schätzt, dass er von seinen Teammitgliedern für seine Leistungen respektiert wird - dies gibt ihm auch Selbstvertrauen und Selbstwert. Dennoch ist er gerade vor einem Spiel meist besonders nervös, hat Angst, er könne sich schlecht anstellen, denkt oft, seinen Gegnern unterlegen zu sein und daran, was passieren könnte, wenn sein Team "durch ihn" verliert, wenn er aus Versehen z.B. ein Eigentor schießt. Letzteres ist ihm ja auch in der vorherigen Saison passiert - woraufhin sein Trainer ihn vor seinen Teamkollegen stark kritisierte. Mit seinen Teamkollegen ist er hin und wieder außerhalb des Fußballs unterwegs, wobei dort einige Rauchen und meinen, dies entspanne sie.
- Reaktion (R): Nach der Niederlage schämt sich H, fühlt sich im Zuge der Nachbesprechung mit dem Trainer unfähig und denkt, beim nächsten Spiel sowieso wieder zu versagen. Er sieht sich als schlechter Fußballspieler und denkt, dass er im Team nun unerwünscht sein könnte, weil er die wichtige Torchance verpasst hat. Außerdem bekommt er leichtes Herzklopfen und ist aufgeregt. Im Anschluss lehnt er es ab, mit seinen Teamkollegen noch etwas essen zu gehen, und will nur noch weg vom Fußballplatz. Schließlich greift er zu Hause zur Zigarette, um sich durch die Nikotinwirkung abzulenken. Und je mehr er raucht, desto besser scheint er sich entspannen zu können.
- Kontingenz (K): Den Kontakt mit seinen Teamkollegen zu vermeiden und zur Zigarette zu greifen, dies hat sich für H bereits in einigen Fällen einer Niederlage bewährt.
- Konsequenz (C): Nach ebensolchen Niederlagen, kann H mit einer Kontaktvermeidung zu seinen Kollegen weitere negative Gefühle und Kognitionen verhindern, diesen entkommen. Außerdem kann er sich mit Rauchen ablenken und wegen der Nikotinwirkung entspannen. Er kann dadurch besonders sein Unbehagen, die negativen Gefühle und Gedanken, die aufkommen(/aufgekommen sind), (etwas) dämpfen. Langfristig - und das weiß H auch - könnte es durch das Rauchen aber zu einem Leistungsabfall im Fußball und gesundheitlichen Folgen kommen. Doch momentan bewährt sich diese Strategie für ihn noch.
Hier lassen sich nun spezifische Schlüsselreize, maladaptive Schemata und ein maladaptiver Bewältigungs-Stil dem SORKC-Schema folgend in ein Verhältnis zu gewissen den Rauchkonsum verstärkenden Konsequenzen setzen:

© Bild: Snuzone
Es wird so ersichtlich, was hier dem Griff zur Zigarette alles vorausgeht, inwieweit Rauchen in ein Netz von psychosozialen Dynamiken eingewoben gilt und wie der Rauchkonsum im Sinne eines maladaptiven Coping-Stils (mit einhergehenden positiven Konsequenzen) befeuert wird.
Davon lassen sich nun eine sogenannte behaviorale- und eine kognitive Selbsthilfemaßnahme mit einem Fokus auf den Rauchstopp ableiten. Dabei wird sich - um es konkreter zu halten - weiter am Beispiel von H orientiert.
>> Könnte dich auch interessieren: Ob im Eishockey oder Fußball - wieso sind Snus im Sport so beliebt?
Eine behaviorale Methode: gezielte Bedürfnisbefriedigung statt Rauchen
Rauchen liefert H im Sinne eines maladaptiven Flight-Bewältigungs-Stils die Möglichkeit, unangenehme emotionale Erregungen zu betäuben. Betäuben kann Rauchen hier insoweit, weil Nikotin zu einer leicht euphorisierenden, entspannenden Stimmungslage führt - für Näheres, lies dazu gerne: Snus Wirkung.
Sowie sich H im Zuge des SORKC-Modells ebendiese verstrickte Funktionsweise seines Rauchkonsums bewusst machen kann, kann er im nächsten Schritt über die Bedürfnisse seiner maladaptiven Schemata (in der Organismus-Variable) gezielt nach (beobachtbaren) möglichen Ersatzverhaltensweisen (für die Reaktions-Variable) Aussicht halten, die über eine Bedürfnisbefriedigung ebenso, dann aber nachhaltiger zu einer Dämpfung der unangenehmen emotionalen und kognitiven Anteile (in der Konsequenz-Variable) führen.*7
Die den maladaptiven Schemata von H zugrundeliegenden Bedürfnisse sind:
- Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen
- Liebe, Respekt und Selbstwert
Die Kunst liegt nun darin, dass er sich mögliche (bekannte) Handlungsweisen überlegt, die ihm ebendiese Bedürfnisse erfüllen können. Das mag recht schwierig klingen und in der Regel scheint der Prozess des Umsetzens solcher Handlungsweisen gegen den Rauchkonsum auch komplex. Außerdem werden wahrscheinlich nicht alle Grundbedürfnisse gleich gut bedient. Dennoch kann sich hier für H eine Chance bieten, sein Handlungsrepertoire gezielt entgegen einem maladaptiven Flight-Bewältigungs-Stil im Sinne des Rauchkonsums nutzen zu können.
Im Falle von H gibt es tatsächlich drei konkrete Handlungsweisen, die er bereits von sich kennt und welche sich leicht als künftige (beobachtbare) Reaktionen anstelle des Rauchens "anwenden" lassen - um den durch eine Fußballniederlage "getriggerten", unangenehmen emotionalen und kognitiven (nicht beobachtbaren) Reaktionen in der Reaktions-Variable gezielt entgegenwirken zu können. Folgende Hobbys bringen H nämlich jeweils in gleichem Maße Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen und Selbstwert:

Das Diagramm zeigt auf, durch welche Hobbys H Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen und Selbstwert gewinnen kann. - © Bild: Snuzone
Würden die Bedürfnisbefriedigungen durch die jeweiligen Hobbys unterschiedlich stark ausfallen, so könnte man dies durch unterschiedlich große Kreisteile auch veranschaulichen. Man könnte so weiterfolgend die mögliche Wirksamkeit für den Fall der Fälle abschätzen. Alternativ funktioniert auch eine Abschätzung durch eine jeweilige Punktevergabe auf einer Skala von 1-10.
Wieso und wie genau wird diese behaviorale Methode wirksam?
Es wird mit den in Aussicht gestellten positiven kognitiven und emotionalen Konsequenzen, die im Zuge der forcierten Bedürfnisbefriedigung mit solchen Handlungsweisen (Hobbys) erzielt werden können, bereits in der Reaktions-Variable gegengesteuert, um einen Ausgleich zu den durch eine Fußballniederlage getriggerten (nicht beobachtbaren) maladaptiven emotionalen und kognitiven Reaktionen zu erreichen. Damit lässt sich das Rauchverhalten gezielt gegen Alternativen austauschen, die dem Rauchen seinen Zweck der Entspannung und Ablenkung rauben. Denn die positiven kognitiven und emotionalen Anteile der Bedürfnisbefriedigung wirken entgegen der Negativen der maladaptiven Schemata und entschärfen diese (in der Konsequenz-Variable) im Sinne von Entspannen und Ablenken ebenso.
Man kann so also gezielt gegensteuern, um dem Rauchen seinen Zweck zu "rauben" - nämlich das Ablenken, Entspannen, das Dämpfen der unangenehmen emotionalen und kognitiven Erregung. Die gezielt evozierten positiven kognitiven und emotionalen Anteile durch die Bedürfnisbefriedigung erfüllen aber nicht bloß denselben Zweck wie das Rauchen, sie lenken gar die (nicht beobachtbaren) Reaktionen infolge der maladaptiven Schemata ins Positive; negative Anteile fallen folglich weg. Dadurch lässt sich sozusagen der maladaptive Flight-Stil aushebeln, und der zweckgerichtete Rauchkonsum künftig verhindern/stoppen. Als Ergebnis tritt in der Konsequenz-Variable eine zum Rauchen analoge Belohnung auf, doch zusätzlich fällt die Bestrafung durch das Rauchen weg (nämlich ein langfristiger Leistungseinbruch, etc.).
Anmerkung: H fällt damit nicht in einen Fight-Coping-Stil hinein, sondern kann vielmehr durch das Befriedigen der Grundbedürfnisse seiner maladaptiven Schemata die ungünstige Bewältigungsreaktion "Rauchen" im Keim ersticken und zugleich die Grundüberzeugungen und Erwartungen der EMS abschwächen. In jedem Fall gewinnt H damit eine Entschleunigung für den das Rauchen befeuernden Flight-Coping-Stil und folglich eine gesunde Alternative dazu. Weiterfolgend kann sich H durch solch alternative, die Grundbedürfnisse stillende Verhaltensweisen künftig einen gewissen, psychisch motivierten Konsumdruck nehmen, auf welchen er sich über die in der Kontingenz-Variable ersichtliche Regelmäßigkeit der "Rauch-Antwort" auf die "Niederlage-Situation" konditioniert hatte.
Eine kognitive Methoden: 7-Spalten-Technik
Eine weitere Selbsthilfetechnik ist die sogenannte 7-Spalten-Technik. Hier spricht man von einer kognitiven Methode, sowie gezielt auf kognitive Anteile maladaptiver Bewältigungs-Stile abgehoben wird. Im Prinzip werden dabei im Zuge eines Gedankenprotokolls sogenannte "automatische Gedanken" ausgemacht, die sich als Ergebnis einer (Teil-)Aktivierung der maladaptiven Schemata in der Reaktions-Variable finden. Weiterführend werden in Spaltenform dafür stützende "Beweise", "Gegenbeweise" und "alternative, ausbalancierte Gedanken" gesammelt - mit dem Ziel, eine Abschwächung der emotionalen Folgen der "automatischen Gedanken" zu erreichen .*8
Im Falle von H gelten als solch automatische Gedanken: "Versagt zu haben, künftig wieder zu versagen und im Team unerwünscht zu sein." Die 7-Spalten-Technik ebendarauf angewandt gestaltet sich folgendermaßen:

© Bild: Snuzone
Wieso und wie genau wird diese Methode wirksam?
Wie man in Spalte 7 sieht, verfolgt diese Methode das Ziel, zu entspannen und maladaptive Reaktionen zu entschleunigen. Was das Rauchen erreicht - nämlich eine Dämpfung von Scham, dem Gefühl, unfähig zu sein, und Nervosität -, lässt sich also auch mit der 7-Spalten-Technik erreichen. Die Wirksamkeit dieser kognitiven Methode kann dabei ähnlich zur erwähnten Behavioralen beschrieben werden, sowie dem Rauchen sein Zweck geraubt wird. Die maladaptive Flight-Reaktion Rauchen wird sozusagen ausgehebelt, weil sie nicht mehr nötig wird. Denn, wenn eine Entspannung und Ablenkung/Dämpfung kognitiver und emotionaler Erregung anderwärtig erreicht wird, verliert sich in dieser Hinsicht die Notwenigkeit zu Rauchen - man muss folglich nichts "wegrauchen, was anderwärtig verpuffen kann".
Im Unterschied zur behavioralen Methode, lässt sich diese kognitive Methode derart verinnerlichen, dass sie in der Reaktions-Variable schneller über rein kognitive Prozesse greifen kann. Eigentlich will man hier sagen: [...] über einen metakognitiven Gesamtprozess greifen kann, sowie es sich hier um einen Reflexionsprozess handelt, der über aufgetretene/auftretende Gedanken ein eingelerntes Denkmuster stülpt, das im Sinne einer metakognitiven Überwachung und Selbstregulierung wirksam wird.
Kombination von behavioraler & kognitiver Selbsthilfetechnik als Schlüssel zum Erfolg
Beide erwähnten Selbsthilfetechniken - in Kombination angewandt - bieten H nun wohl das nötige Rüstzeug, um in den bekannten Stresssituationen einer Fußballniederlage die ungünstige "Rauch-Antwort" endlich verabschieden zu können.
Nota bene: Die zwei abgeleiteten Selbsthilfetechniken können als Hausmittel beim Rauchausstieg in der erwähnten Weise helfen, stellen aber in keiner Weise einen Ersatz für eine professionelle Psychotherapie dar. Das Ziel dieses Beitrages war vielmehr, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Rauchausstieg vielen nicht bloß wegen möglicher Entzugssymptome so schwer fällt, sondern dass hier psychosoziale Dynamiken eben auch eine wesentliche Rolle spielen können. Die beschriebene situative Verhaltensanalyse lässt sich damit höchstens als Orientierungshilfe verstehen, wobei die Selbstreflexion dadurch angeregt sein möchte. Die davon abgeleiteten Selbsthilfetechniken lassen sich in der Folge höchstens als Ratgeber verstehen.
>> Könnte dich auch interessieren: Raucherentwöhnung leicht(er) gemacht
-----------------------------------------------
Quellen (zuletzt abgerufen am 08.09.25):
*1 https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/verhaltensanalyse
*2 https://flexikon.doccheck.com/de/SORKC-Modell
*3 https://schematherapie-rhein-ruhr.de/schemata-nach-j-young/
*4 https://www.therapie.de/psyche/info/therapie/schematherapie/schemata/
*5 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schematherapie: Ein praxisorientiertes Handbuch. Beltz Verlag.
*6 https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-621-28224-6.pdf
*7 https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-guide-to-schema-therapy/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1 ; insbesondere: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1/9781108927475c1_1-15.pdf/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes.pdf
*8 https://ulb-dok.uibk.ac.at/download/pdf/7714137.pdf